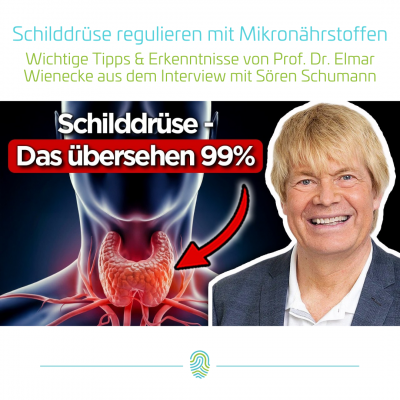Die Schilddrüse steuert wesentliche Stoffwechselprozesse im menschlichen Körper. Im Podcast von Sören Schumann ging unser wissenschaftlicher Leiter und renommierter Sportwissenschaftler Prof. Dr. Elmar Wienecke auf aktuelle Forschungsergebnisse, seine diagnostische Praxis und wirksame Maßnahmen zur Unterstützung der Schilddrüsengesundheit ein und erklärt, wie Sie Ihre Schilddrüse beim Regulieren mit Mikronährstoffen unterstützen können.
Dieses Interview bringt Licht ins Dunkel häufig übersehener Zusammenhänge von Schilddrüsenwerten, Mikronährstoffen, Bewegungsverhalten bis hin zu genetischen Faktoren.
Schilddrüsenwerte korrekt interpretieren: Wieso es mehr als den TSH-Wert braucht
Prof. Dr. Elmar Wienecke hebt hervor, wie irreführend das Vertrauen auf den „normalen“ TSH-Basalwert allein sein kann. Viele Menschen leiden unter Befindlichkeitsstörungen und Dysbalancen, obwohl ihre gemessenen TSH-Werte im offiziellen Referenzbereich liegen. Seine Analysen zeigen jedoch, dass sich die vegetative Balance des Körpers meist nur bei TSH-Werten zwischen 1,6 und 2,2 ergibt. Werte außerhalb dieses Bereichs führen häufig zu Dysregulation, das heißt, Sie sind objektiv nicht krank, verspüren aber dennoch Symptome wie innere Unruhe, Schlafprobleme, fehlende Regeneration nach sportlicher Belastung oder unerklärliche Gewichtszunahme.
Zentrale Schilddrüsen-Parameter wie freies T3, freies T4 und insbesondere Schilddrüsenantikörper (TPO-, TRAK-Werte) werden oft nicht routinemäßig gemessen, sind aber unerlässlich, um versteckte Erkrankungen wie Hashimoto-Thyreoiditis oder Morbus Basedow zu entdecken.
Häufigkeit von Schilddrüsenerkrankungen und genetische Disposition
Laut Prof. Wienecke hatten in einer groß angelegten Studie jede zweite Frau über 50 und zahlreiche Kinder mit Hyperaktivitätsproblemen bereits Anzeichen einer Hashimoto-Thyreoiditis, oft ohne klinisch manifeste Symptome. Auch etwa ein Drittel der Leistungssportler zeigte Anzeichen von Schilddrüsenproblemen. Insgesamt sind etwa 65% der untersuchten Männer und Frauen vorbelastet.
Genetische Veranlagung, insbesondere bei sehr jungen Betroffenen, spielt dabei häufig eine entscheidende Rolle. Typische Verhaltensauffälligkeiten oder unerklärbare Symptome sollten daher immer Anlass sein, Schilddrüsenantikörper neben den Basiswerten zu überprüfen.
Hier folgt ein detaillierter Einblick in die konkreten Aussagen von Prof. Dr. Elmar Wienecke, mit Fokus auf die tieferen Details, Fallbeispiele und praktische Empfehlungen.
Die Aussagekraft der Laborwerte – „Wohlfühlbereich“ und praktische Konsequenzen
Prof. Wienecke schildert aus seiner jahrzehntelangen Praxis, dass die Standardreferenzbereiche bei Schilddrüsenlaborwerten meist zu weit gefasst sind. Entscheidend für das Wohlbefinden sei nicht der „Normalbereich“, sondern ein optimierter TSH-Spiegel zwischen 1,6 und 2,2. Viele Patienten mit TSH-Werten über 2,5 fühlen sich antriebslos, müde und nehmen unerwünscht zu obwohl keine klassische Schilddrüsenerkrankung diagnostiziert werden kann. Ebenso führen TSH-Werte unter 1,3 häufig zu innerer Unruhe, Schlafproblemen und der sprichwörtlichen HB-Männchen Mentalität.
Praktische Fallbeispiele und Therapieansätze: Was tun bei „schwierigen“ Schilddrüsenwerten?
Im Podcast schildert Prof. Wienecke einige typische Patientenfälle:
Viele Menschen fühlen sich trotz „unauffälligem“ TSH unwohl. Prof. Wienecke beschreibt, wie er seinen eigenen TSH-Wert über gezielte Mikronährstofftherapie – zum Beispiel mit Jod (bei Werten über 2,5, jedoch nicht bei Hashimoto) regulieren konnte. Er berichtet, wie bei gezielter Zufuhr von 100–150μg Jod pro Tag, Erfolge bei der Normalisierung des Wohlfühlbereichs erzielt werden, wobei Verbesserungen häufig nach 5–6 Wochen spürbar sind.
Ein spezifisches Beispiel: Bei zu niedrigen TSH-Werten (<1,3) kann die Gabe von Multivitaminpräparaten besonders bei enthaltenem Jod die Symptome verschlimmern. Hier ist stattdessen eine Reduktion von Jod sinnvoll, um das vegetative Nervensystem zu beruhigen. Magnesium in aufgeteilten Gaben über den Tag (150–200mg morgens und abends) dämpft ein übererregtes Nervensystem zusätzlich.
Aminosäuren und Eiweißversorgung – praktische Studienergebnisse
Eine zentrale Rolle spielt für Prof. Wienecke die gezielte Gabe von bestimmten Aminosäuren – insbesondere Phenylalanin und Tyrosin zur Unterstützung der Schilddrüsenregulation. Er berichtet von Studienergebnissen, bei denen 1.500mg Phenylalanin, gegeben über fünf bis sechs Wochen, in Kombination mit Jod bei beginnender Unterfunktion messbare Verbesserungen der Schilddrüsenwerte und der allgemeinen Stressresilienz erzielten.
Prof. Wienecke widerspricht vehement der noch verbreiteten Auffassung, dass normale Eiweißzufuhr (0,8g pro Kilogramm Körpergewicht) ausreichend sei. Gerade ältere Menschen und Frauen nach den Wechseljahren profitieren aus seiner Erfahrung von 1,8–2g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, idealerweise ergänzt durch isolierte Aminosäuren wie in Erbsenprotein. Dies habe, wie in einer Masterarbeit belegt, positive Auswirkungen sowohl auf Schilddrüsenwerte als auch auf das vegetative Wohlbefinden.
Eisen/Ferritin und ihre Bedeutung für die Schilddrüse
Bis zu 70–80 Prozent der Schilddrüsenhormonproduktion sind laut Prof. Wienecke direkt abhängig vom Eisenstatus. Er empfiehlt, bei Frauen Ferritinwerte über 80ng/ml (besser noch 120ng/ml), bei Männern über 140ng/ml anzustreben. Besonders bei regelmäßigem Blutverlust (Menstruation bei Frauen, intensive sportliche Belastung) sind Mängel weit verbreitet. Der Einfluss ist konkret belegt: Im Podcast schildert Prof. Wienecke, wie die gezielte Eisentherapie bei einem männlichen Leistungssportler die Schilddrüsen- und Regenerationsparameter innerhalb weniger Wochen signifikant verbessert hat.
Ein wichtiger Hinweis laut Prof. Wienecke: Ferritin als Entzündungsmarker kann bei stillen Entzündungen verfälscht sein. Daher empfiehlt er zusätzlich die Bestimmung des löslichen Transferrin-Rezeptors (sTFR).
Umgang mit Medikamenten – Individualtherapie statt Standardprotokoll
Im Podcast betont Prof. Wienecke, dass Schilddrüsenmedikamente wie L-Thyroxin zwar notwendig sein können und bei dauerhafter Unterfunktion unbedenklich sind, dass jedoch häufig die Dosis zu schnell gesteigert wird, ohne die Konversion von T4 nach T3 zu berücksichtigen. Omega-3-Fettsäuren werden als effektives Mittel zur Steigerung der Zellmembran-Permeabilität empfohlen, um die Umwandlung zu unterstützen.
Darmgesundheit und Schilddrüsenerkrankungen
Spannend ist Wieneckes Hinweis auf die enge Beziehung zwischen Darm und Schilddrüse. Bis zu 80% der Schilddrüsenhormonregulation finden über den Darm statt. Deshalb empfiehlt er, vor jeder Anpassung der Medikation zunächst eine Darm-Sanierung und entsprechende Diagnostik (z.B. Zonulinmessung) durchzuführen, insbesondere bei Nachweis eines „Leaky Gut“.
Wann und wie sollte man messen? Konkrete Tipps
Ein herausragender praktischer Ratschlag: Nach starken körperlichen Belastungen – etwa bei Leistungssportlern am Tag nach einem Spiel – steigen die TSH-Werte stressbedingt an und verfälschen das Ergebnis. Eine Blutentnahme sollte daher in Erholungsphasen erfolgen. Für Frauen empfiehlt Prof. Wienecke, die Labordiagnostik fünf bis sechs Tage nach der Menstruation durchzuführen, um zyklusbedingte Schwankungen zu minimieren.
Mikronährstoffe: Schlüssel zur Schilddrüsengesundheit
Die Rolle von Mikronährstoffen ist zentral im Interview. Fehlen bestimmte Mikronährstoffe, hat dies nachweislich negative Auswirkungen auf die Schilddrüse. Besonders hervorgehoben werden:
- Fettsäuren (Omega-3): Die entzündungshemmenden Eigenschaften sind für die Senkung von Entzündungsmarkern (z.B. TPO-Antikörper bei Hashimoto) besonders effektiv.
- Selen: Einer der wichtigsten Regulationsstoffe für die Schilddrüse, akut mangelhaft in Deutschland und Europa. 150 bis 200 Mikrogramm täglich können prophylaktisch eingenommen werden.
- Eisen: Über 70% der Schilddrüsenhormonentgleisungen sind auf einen niedrigen Ferritinwert zurückzuführen. Frauen sollten Ferritinwerte über 80ng/ml, Männer über 140ng/ml anstreben. Da Ferritinwerte bei Entzündungen verfälscht sein können, empfiehlt Prof. Wienecke die zusätzliche Bestimmung des sTFR (Transferrin-Rezeptor).
- Jod, Zink, Vitamin D, MSM: Ebenfalls maßgeblich für die Schilddrüsenregulation und ergänzend sinnvoll.
Bei der Auswahl und Kombination der Mikronährstoffe ist Vorsicht geboten, da es zu Kontraindikationen kommen kann. Willkürliche Einnahme oder Überdosierung kann negative Folgen haben, daher ist eine gezielte Analyse und Absprache mit dem Arzt erforderlich.
Medikamentöse und natürliche Behandlungsmöglichkeiten
Die schulmedizinische Therapie umfasst meist die Gabe von L-Thyroxin bei Unterfunktion oder Carimazol bei ausgeprägter Überfunktion. Doch häufig, so Prof. Wienecke, lassen sich insbesondere leichte Dysregulationen und Befindlichkeitsstörungen bereits mit der gezielten Gabe von Aminosäuren wie Tyrosin und Phenylalanin, kombiniert mit Mikronährstoffen, regulieren.
Ein Beispiel: Bei TSH-Werten von 0,6 bis 0,7, Schlaflosigkeit und Unruhe zeigte in Studien die Gabe von 800-900mg Tyrosin und ca. 1.200mg Phenylalanin eine Normalisierung des Hormonhaushalts innerhalb von 12 Wochen.
Zusammenhang von Darm, Stress und Schilddrüse
Negative Veränderungen im Darm, wie das sogenannte Leaky-Gut-Syndrom, können eine Schilddrüsendysregulation verstärken. Prof. Wienecke empfiehlt, bei auffälligen Schilddrüsenwerten auch den Darm zu sanieren, beispielsweise mit Glutamin und Ballaststoffen.
Permanenter negativer Stress – psychisch wie physisch – beeinflusst die Schilddrüse direkt. Dauerstress kann Ursache und Folge von Schilddrüsenerkrankungen zugleich sein. Daher sollte im Rahmen ganzheitlicher Therapien besonderes Augenmerk auf Stressmanagement und eventuelle Darmsanierung gelegt werden.
Praktische Empfehlungen für Diagnostik und Alltag
Unbedingt sollte bei Schilddrüsendiagnostik:
- Eine differenzierte Messung inklusive TSH, freies T3/T4 und Antikörper erfolgen
- Ein qualitativer Ultraschall der Schilddrüse durchgeführt werden, Blutwerte allein sind häufig nicht ausreichend
- Ferritin und im Zweifelsfall sTFR-Wert kontrolliert werden
- Sie nach medizinischer Beratung individuelle Mikronährstoffpräparate auswählen und deren Dosierung regelmäßig überprüfen lassen
Vermeidung von Fehlern bei Supplementierung und Training
Sportler – aber auch ambitionierte Freizeitsportler – sind besonders anfällig für Schilddrüsen-Dysregulationen infolge von hohen Trainingsbelastungen. Prof. Wienecke warnt davor, nach starker körperlicher Belastung direkt Schilddrüsenwerte messen zu lassen, da akuter Stress die Ergebnisse verfälscht. Zudem erhöht intensiver Sport das Risiko für Infekte, sofern die Versorgung mit Mikronährstoffen suboptimal ist.
Fazit: Schilddrüsengesundheit umfassend betrachten
Wer sich müde, gestresst, unruhig oder antriebslos fühlt, sollte an eine mögliche Schilddrüsenstörung denken und eine umfassende Labor- und Ultraschalldiagnostik anstreben. Die gezielte Gabe von Mikronährstoffen (abgestimmt auf die eigenen Werte und in Abstimmung mit medizinischem Fachpersonal) kann signifikant zur Besserung beitragen und in vielen Fällen unnötige Medikation vermeiden.
Um weitere Details, persönliche Erfahrungen und praktische Tipps aus erster Hand zu hören, empfehlen wir Ihnen, das vollständige Video des Interviews mit Prof. Dr. Elmar Wienecke anzuschauen: