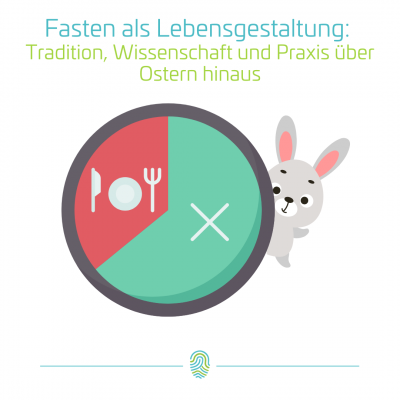Mit den Ostertagen endet für viele Menschen die traditionell am Aschermittwoch begonnene Fastenperiode. Fasten ist ein uraltes Element menschlicher Kultur, das heute eine bemerkenswerte Renaissance erlebt. Wir möchten mit Ihnen auf den Brauch schauen und uns fragen, welche Mikronährstoffe beim Fasten besonders zu beachten sind.
Hierzu ziehen wir euch ein ausführliches Gespräch zwischen Dr. med. Volker Schmiedel, Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin im Format „Naturmedizin“ bei QS24 mit ein. Dort werden die historischen, medizinischen und praktischen Aspekte des Fastens beleuchtet.
Historische und kulturelle Wurzeln des Fastens
Fasten ist in nahezu allen Kulturen und Religionen als Ritual des Verzichts und der Reinigung verankert. Ob als Vorbereitung auf spirituelle Ereignisse, als Zeichen der Trauer oder als Protestform – der bewusste Nahrungsverzicht hat viele Gesichter. Schon Hippokrates empfahl, kleinere Beschwerden lieber durch Fasten als durch Medikamente zu behandeln, und auch im Mittelalter galt Fasten als medizinisch sinnvoll.
„Wenn die Krankheit auf ihrer Höhe ist, dann muss die knappste Nahrungszufuhr erfolgen“ Hippokrates
In der Neuzeit wurde das Fasten neu entdeckt, etwa als therapeutisches Mittel oder als Teil von Diäten und als politisches Instrument nutzte beispielsweise Mahatma Gandhi das Fasten.
Welche Mikronährstoffe beim Fasten wichtig sind
Während des Fastens schaltet der Körper in einen Regenerationsmodus, nutzt gespeicherte Energie und beginnt mit der Zellreinigung (Autophagie). Gleichzeitig werden aber auch gespeicherte Mikronährstoffe mobilisiert und verbraucht. Besonders kritisch sind dabei:
- Vitamin D: Wichtig für Knochen, Immunsystem und Stimmung. Die Aufnahme aus Nahrung entfällt beim Fasten, die körpereigene Produktion über die Haut reicht in unseren Breitengraden oft nicht aus
- Omega-3-Fettsäuren: Entzündungshemmend, wichtig für Gehirn und Herz. Werden meist über fettreiche Mahlzeiten aufgenommen
- Zink: Unterstützt das Immunsystem, aber eine Einnahme auf nüchternen Magen kann schnell zu Übelkeit führen
- Eisen: Essenziell für die Blutbildung, sollte möglichst nicht auf leeren Magen eingenommen werden, da es sonst den Magen reizen kann und schlechter aufgenommen wird
Fastenformen und ihre medizinische Bedeutung
Heute gibt es zahlreiche Fastenmethoden, die sich in Dauer und Strenge unterscheiden:
- Wasserfasten: Kompletter Verzicht auf Nahrung, nur Wasser ist erlaubt. Strikteste Form des Fastens, die nur unter medizinischer Aufsicht durchgeführt werden sollte, da das Risiko für Nährstoffmangel hoch ist.
- Buchinger-Fasten: Flüssige Nahrung wie Gemüsebrühe, Tee mit etwas Honig und Fruchtsaftschorle, insgesamt 200–300 Kalorien pro Tag. Für mehrere Tage wird also auf feste Nahrung verzichtet. Hier ist die Versorgung mit Mikronährstoffen besonders kritisch
- Intermittierendes Fasten: Zeitlich begrenzter Verzicht, z.B. 16–18 Stunden täglich ohne Nahrung. 16 Stunden fasten, 8 Stunden Essensfenster. Sehr beliebt, da flexibel und alltagstauglich. In der Fastenzeit sind nur kalorienfreie Getränke wie Wasser, Tee oder schwarzer Kaffee erlaubt.
- Therapeutisches Fasten: Gezielter Einsatz bei bestimmten Erkrankungen oder zur Unterstützung medizinischer Therapien.
- Selektives Fasten (z.B. Zucker, Alkohol) Eine mildere Fastenform, bei der gezielt auf bestimmte Genussmittel verzichtet wird. Hier bleibt die Mikronährstoffaufnahme in der Regel weitgehend erhalten
Dr. Schmiedel betont, dass Fasten nicht für jeden geeignet ist. Bei aktiven Krebserkrankungen, schweren psychischen Störungen, Essstörungen oder fortgeschrittenen Stoffwechselkrankheiten wie Leberzirrhose ist Fasten kontraindiziert. Besonders bei onkologischen Patienten ist Vorsicht geboten: Während aktiver Tumorphasen oder kurz nach Operationen und Bestrahlungen sollte nicht gefastet werden. Aus seiner Praxiserfahrung kann erst nach erfolgreicher Tumorbehandlung Fasten unterstützend eingesetzt werden.
Fasten und Krebs: Chancen und Risiken
Ein spannender Aspekt ist das sogenannte „Chemotherapie-Fasten“. Hierbei wird ein kurzfristiges Fasten (ein Tag vor, während und ein Tag nach der Chemotherapie) eingesetzt, um die Verträglichkeit zu verbessern. Die Theorie dahinter: Gesunde Zellen schalten im Fastenmodus auf „Sparflamme“ und teilen sich weniger, während Krebszellen weiterhin aktiv sind und dadurch empfindlicher gegenüber der Chemotherapie werden. Studien an Tieren zeigen, dass gefastete Tiere die Chemotherapie besser vertragen als nicht gefastete.
Auch eine ketogene Ernährung, also eine Ernährung mit sehr wenig Kohlenhydraten und viel Fett, kann bei manchen Krebspatienten sinnvoll sein. Entscheidend ist jedoch, ob bestimmte Marker wie das TKTL1-Protein erhöht sind, um die Wirksamkeit der ketogenen Diät abzuschätzen.
Fasten und Gewichtsreduktion: Jojo-Effekt vermeiden
Viele Menschen fasten, um Gewicht zu verlieren. Dr. Schmiedel warnt jedoch vor dem klassischen Jojo-Effekt: Während des Fastens fährt der Körper den Stoffwechsel herunter. Nimmt man nach dem Fasten wieder wie gewohnt Nahrung zu sich, bleibt der Stoffwechsel noch einige Zeit auf Sparflamme, was zu einer schnellen Gewichtszunahme führen kann.
Fasten macht daher nur dann Sinn, wenn man durch gezielte Analyse und Anamnese die Ursachen für das eigene Essverhalten erkennt und gezielt ändert – sei es Stressessen, Frustessen oder ständiges Naschen. Fasten kann ein Einstieg in eine nachhaltige Ernährungsumstellung sein, wenn die individuellen Auslöser für Übergewicht bearbeitet werden.
Fasten bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen
Bei vielen entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma, Asthma, Neurodermitis, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn kann Fasten sehr hilfreich sein. Der Darm wird entlastet, die Immunreaktionen können sich regulieren, und der Körper hat die Möglichkeit, sich zu regenerieren.
Physiologische Effekte: Autophagie, Parasympathikus und Heilung
Ein zentrales Stichwort ist die Autophagie – ein zellulärer Reinigungsprozess, bei dem beschädigte Zellbestandteile abgebaut werden. Für die Entdeckung der Autophagie erhielt der japanische Forscher Yoshinori Ohsumi 2016 den Nobelpreis für Medizin. Während des Fastens aktiviert der Körper diesen Prozess besonders stark, was als Schlüssel zur Prävention und Behandlung vieler Volkskrankheiten wie Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt.
Fasten begünstigt zudem die Aktivierung des Parasympathikus, des „Entspannungsnervs“. Nach einigen Tagen Fasten schaltet der Körper in einen Zustand der Ruhe und Regeneration, Blutdruck und Stresslevel sinken, und Reparaturprozesse werden gefördert. Dies erklärt auch, warum viele Menschen während Infektionen keinen Appetit haben – der Körper will sich auf Heilung und Gesundung konzentrieren und nicht auf Verdauung.
Praktische Tipps für sicheres und effektives Fasten
- Vorbereitung mit Mikronährstoffen: Vor dem Fasten empfiehlt Dr. Schmiedel, die Nährstoffspeicher aufzufüllen, da viele Menschen heute bereits mit Defiziten starten.
- Fastenform wählen: Das Buchinger-Fasten ist für viele angenehmer als reines Wasserfasten, da es kleine Mengen an Flüssignahrung erlaubt.
- Supplementierung mit Mikronährstoffen: Während des Fastens empfiehlt sich die Zufuhr von Magnesium, Calcium und Kalium, um Mangelerscheinungen und Übersäuerung vorzubeugen. Fettlösliche Vitamine wie D, E, K2 und Omega-3 sollten immer zu einer fettreichen Mahlzeit eingenommen werden – nicht während des Fastens, da sie sonst nicht aufgenommen werden.
- Dauer und Häufigkeit: Intermittierendes Fasten (16–18 Stunden ohne Nahrung) kann dauerhaft praktiziert werden und zeigt bereits positive Effekte. Längere Fastenperioden sollten seltener durchgeführt und ggf. ärztlich begleitet werden. Dr. Schmiedel empfiehlt, mindestens einmal im Jahr eine Fastenwoche einzulegen.
Fazit: Fasten als Schlüssel zu Gesundheit und Lebensqualität
Fasten ist weit mehr als ein kurzfristiger Ernährungstrend. Es ist ein tief in der Menschheitsgeschichte verwurzeltes Gesundheitswerkzeug, das – richtig angewendet – zahlreiche positive Effekte auf Körper und Geist entfalten kann.
Entscheidend ist jedoch, individuelle Kontraindikationen zu beachten, sich gut vorzubereiten und das Fasten als Einstieg in eine nachhaltige Veränderung des Lebensstils zu begreifen. Wer sich auf den Prozess einlässt, kann nicht nur Gewicht verlieren, sondern auch Entzündungen lindern, Heilungsprozesse fördern und die eigene Resilienz stärken.
In diesem Video erfahren Sie noch weitere wichtige und interessante Punkte von Dr. Schmiedel: